|
<< zurück
|
Was ist Regelung?
Regelung
ist im Grunde ganz einfach: Sie ist keine spezielle Technik,
sondern ein umfassendes Prinzip, das in der ganzen Welt die
Ordnung vom Chaos trennt. In der Technik können Sensoren und
Elektronik die Eigenschaften mechanischer Systeme entscheidend
verbessern.
Mit Freude an HiFi und mehr als fünfzig Jahren Erfahrung in der Entwicklung von
Sensoren für Lautsprecher haben wir viel lernen können und dürften in
diesem Bereich technologisch führend sein.
Was kann Regelung?
Sie korrigiert zunächst den Bereich der
"linearen" Fehler. Das sind die viel diskutierten Effekte um
Frequenz- und Phasenverlauf. Im Gegensatz zu einer fest programmierten Steuerung ("Filterung", "Entzerrung") wirkt sie auch
dann, wenn sich die mechanischen Parameter des Lautsprechers ändern (mit Zeit, Temperatur, ...).
Noch wichtiger ist, dass sie auch die "nichtlinearen" Fehler erfasst.
Das ist zunächst der grobe Fehler durch den
nichtlinearen
Antrieb aber auch die Gruppe vielfältiger mechanischer, elektrischer und
magnetischer Nebeneffekte. Diese sind teilweise komplex und oft
existiert für sie keine inverse Übetragungsfunktion, so dass sie ohne
Sensorik nicht kompensierbar sind.
Lautsprecher sind keine Musikinstrumente.
Lautsprecher sind Technik. Deshalb sind hier alle Einzelheiten
berechenbar und messbar. Über technische Fakten wird viel geredet,
sie sind aber entweder richtig oder falsch. Manchmal sind sie auch
richtig, aber schlicht irrelevant.
Dabei ist die Lautsprechertechik im Prinzip ganz einfach:
Ein Lautsprecher soll das elektrische Musiksignal in eine mechanische
Bewegung abbilden. Da soll also nichts "schwingen"
oder
"klingen".
Wenn Boxen "boxy" klingen.
Dann liegt das daran, dass (ungeregelte) Lautsprecher
schwingungsfähige Systeme mit einer nichtlinearen
Übertragungsfunktion sind.
Die hörbare Folge ist, dass sie dem Musiksignal Klänge
hinzufügen, die im Original nicht vorhanden sind.
Kollateral werden dabei auch die Klänge der einzelnen Musikinstrumente
voneinander abhängig, also miteinander vermischt. (Fachbegriff
"Intermodulation")
Diese Mischprodukte sind schon in einem einfachen Experiment zu sehen:
Werden mehrere Töne gleichzeitig über einen Lautsprecher
wiedergegeben, dann soll die Bewegung der Membran diese Töne
abbilden.
Als Beispiel geben wir 30Hz, 80Hz und 110 Hz auf eine FM 3 und messen
mit einem handelsüblichen Bewegungssensor die Bewegung der Membran:
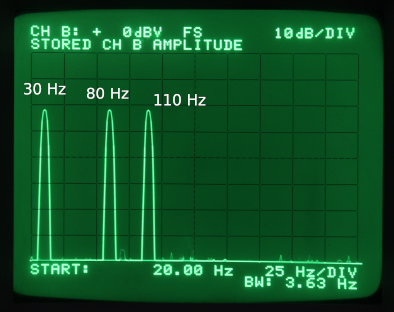
Das Spektrum zeigt erwartungsgemäß diese drei Frequenzen in gleicher Amplitude.
Wird in diesem Aufbau die Regelung abgeschaltet, dann arbeitet die Box wie ein konventionelles System:
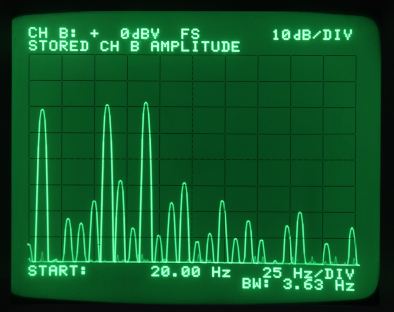
"What you see is what you get": Eine Fülle artefakter Mischprodukte, also Töne, die im Original nicht vorhanden sind.
Dabei modulieren sich unterschiedliche Töne nicht nur gegenseitig,
sondern auch sich selbst, was oft als
"harmonisch" bezeichnet, zur Gestaltung "warmer Klänge"
eingesetzt und in der blumigen Sprache von Sommeliers beschrieben
wird.
Musikinstrumente leben von Intermodulation.
Wird auf einer Geige ein einzelner Ton
angespielt,
dann schwingt nicht nur diese eine Saite, sondern das ganze Instrument
antwortet mit einem Klang. Dieser enthält die
Spektren all ihrer einzelnen Teile mit
allen Verkopplungen und
Abhängigkeiten zwischen ihnen. Sie bestimmen den Charakter eines
Instruments und vielleicht ist das "Geheimis der Stradivari" auch das Wunder
der Intermodulation.
Aber: Lautsprecher sind keine Musikinstrumente, sie sind eher ihr
Gegenteil. Es ist deshalb schöner, wenn sie nicht
versuchen, die Arbeit
von Instrumentenbauern und Musikern zu imitieren, zu verbessern oder zu
übertönen.
|
|
Technischer Hintergrund der Lautsprecherregelung.
Lautsprecher haben die Aufgabe, das elektrische Musiksignal in
mechanische Bewegung zu wandeln. Die Präzision dieser Wandlung
entscheidet über seine Qualität.
Der "elektrodynamische Lautsprecher" ist auch nach 150 Jahren
noch ein überzeugendes Prinzip. Obwohl viele Details
ständig weiter entwickelt werden, bleibt aber ein
grundsätzliches Problem: Die Länge der "Schwingspule" und die
Höhe des Magneten sind begrenzt. Dadurch ändert sich die
antreibende Kraft mit der Auslenkung aus der Ruhelage. Das
Verhältnis von elektrischem Strom und mechanischer Kraft ist also
nicht linear. |
|

|
|
 |
|
Wie stark dieser Effekt in der Praxis ist, kann man mit einem
Laser-Abstandssensor an einem Tieftöner (hier eine
"Langhub"-Ausführung) ganz einfach messen:
 
Man sieht, dass die mechanische Auslenkung (x-Achse) dem Strom
(y-Achse) nicht proportional entspricht. Die Kurve wird schon ab etwa 1
mm Hub deutlich nichtlinear.
(Man erkennt auch eine Hystereseschleife,
also unterschiedliches Verhalten, je nachdem ob sich die Membran
nach vorne oder nach hinten bewegt. Sie entsteht durch die
Materialeigenschaften von Gummisicke und Zentrierung und
ist ein Beispiel für Effekte, die nicht eindeutig bestimmt
und deshalb einer (analogen oder digitalen) Steuerung nicht
zugänglich sind. Regelung hingegen fragt nicht, wie ein Fehler
entstanden ist, sondern korrigiert ihn einfach.) |
|
In
dem gleichen Versuchsaufbau kann man die Schwingspule mit einem Sinus
ansteuern und wie oben die mechanische Auslenkung messen:
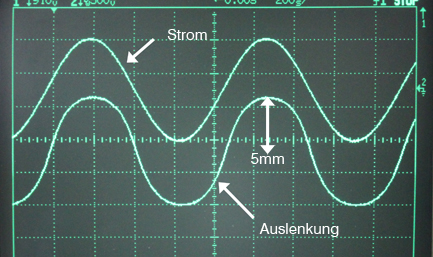
Die Auslenkung ist wegen der nachlassenden Kraft oben und
unten abgeflacht. Diese Verformung erzeugt Töne, die als
"harmonische Oberwellen" bezeichnet werden. Der Begriff "harmonisch"
kommt daher, dass ihre Frequenzen in dem als harmonisch
empfundenen Frequenzraster von Musikinstrumenten liegen. Bei
Lautsprechern sind sie ein Fehler, der auf Kosten von Klarheit
"Bassstärke" oder "musikalische Wärme" vortäuschen soll, die in Wahrheit nicht vorhanden sind.
Dieses Oberwellenspektrum ändert zudem die
Klangfarben der Musik ständig mit der Auslenkung der Membran. Auch
Musiker variieren durch dynamische Abstufungen die Klangfarben ihres
Instruments, aber differenzierter und nach anderen Kriterien als
eine Schwingspule.
Die Regelung kehrt die Verhältnisse in dem Bild um: Der Sensor
korrigiert nun über den Verstärker den Strom so, dass nun die
Membranbewegung eine saubere Sinuskurve ist.
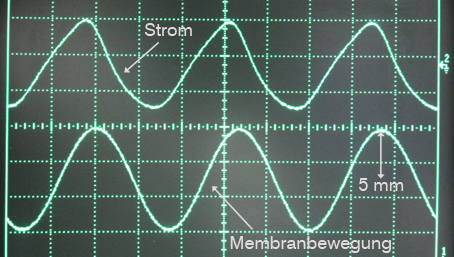 |
|
|
Wieder
mit der gleichen Anordnung (Lasermessung der Auslenkung) kann man auch
sehen, wie die Lautsprecher-Intermodulation als "hässliche Schwester"
der "Harmonischen" entsteht.

Wird dem Strom mit der tiefen Frequenz ein weiterer, höherer
Tön hinzugefügt, dann schwankt der Pegel des hohen Tones mit
der Auslenkung des tieferen. Der Grund ist auch hier wieder, dass die
Antriebskraft umso schwächer wird, je weiter die Schwingspule
aus der mittleren Position kommt. Diese Amplitudenmodulation erzeugt Nebenfrequenzen
auch außerhalb des harmonischen Rasters. Sie ist eine Hauptursache
für "boxy" und wird durch Regelung wirksam korrigiert. |
|
Welche Qualität ist durch Regelung praktisch erreichbar?
 In
der komplexen HiFi-Technik ist der Wert "Klirrfaktor" sicher nicht die
einzige relevante Kenngröße. Da sie aber eng mit
Intermodulation verbunden ist, sagt sie aber einiges über die
Sauberkeit des ganzen Systems aus. In
der komplexen HiFi-Technik ist der Wert "Klirrfaktor" sicher nicht die
einzige relevante Kenngröße. Da sie aber eng mit
Intermodulation verbunden ist, sagt sie aber einiges über die
Sauberkeit des ganzen Systems aus.
Wenn z.B. bei der FM 7 schon ein Test mit einem
einfachen Analyzer bei einem Tiefton-Hub von +/- 1,5cm
einen Klirrwert
von 0,27% anzeigt, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass sie in
einer anderen Liga spielt als konventionelle Lautsprecher.
|
|
Durch
Regelung ist der Frequenzverlauf frei von Resonanzen und die
Klirrwerte sind gleichbleibend auf diesem extrem niedrigen Niveau.

Für eine solche Messung bei Pegeln um 100dB und einer Bandbreite
bis 10Hz ist man auch mit sehr guten Messmikrofone schon an
deren Messgrenzen.
durchgezogene Linie oben: Schalldruck (ab 10 Hz)
gestrichelte Linie: K3
durchgezogene Linie unten: K2
Y-Achse (Magnitude): Der Skalenwert -70dB entspricht 0,3% (30Hz), -80dB 0,1% |
|
Warum sind nicht alle Lautsprecher geregelt?
Voraussetzungen für geregelte Systeme sind ein gutes Aktivkonzept, speziell
konstruierte hochwertige Mechanik (Chassis), präzise
Sensoren und nicht zuletzt Enthusiasmus und Know-How.
Damit ist der Aufwand groß, der wirklich
anspruchsvolle Teil des
Marktes ist aber klein und "Sound-Design" ist für den
Massenmarkt besser geeignet. Vielleicht ist das aber kein Nachteil: In
der Vergangenheit waren die Versuche, die HiFi-Idee in die Breite zu
bringen
nicht gut für ihre Höhe.
In der konservativen Szene werden geregelte Aktivlautsprecher
gegenüber gewohnten Anlagen und gewohnten Klängen (durchaus
zutreffend) als disruptive Änderung wahrgenommen. |
|
|
|
|
|
|